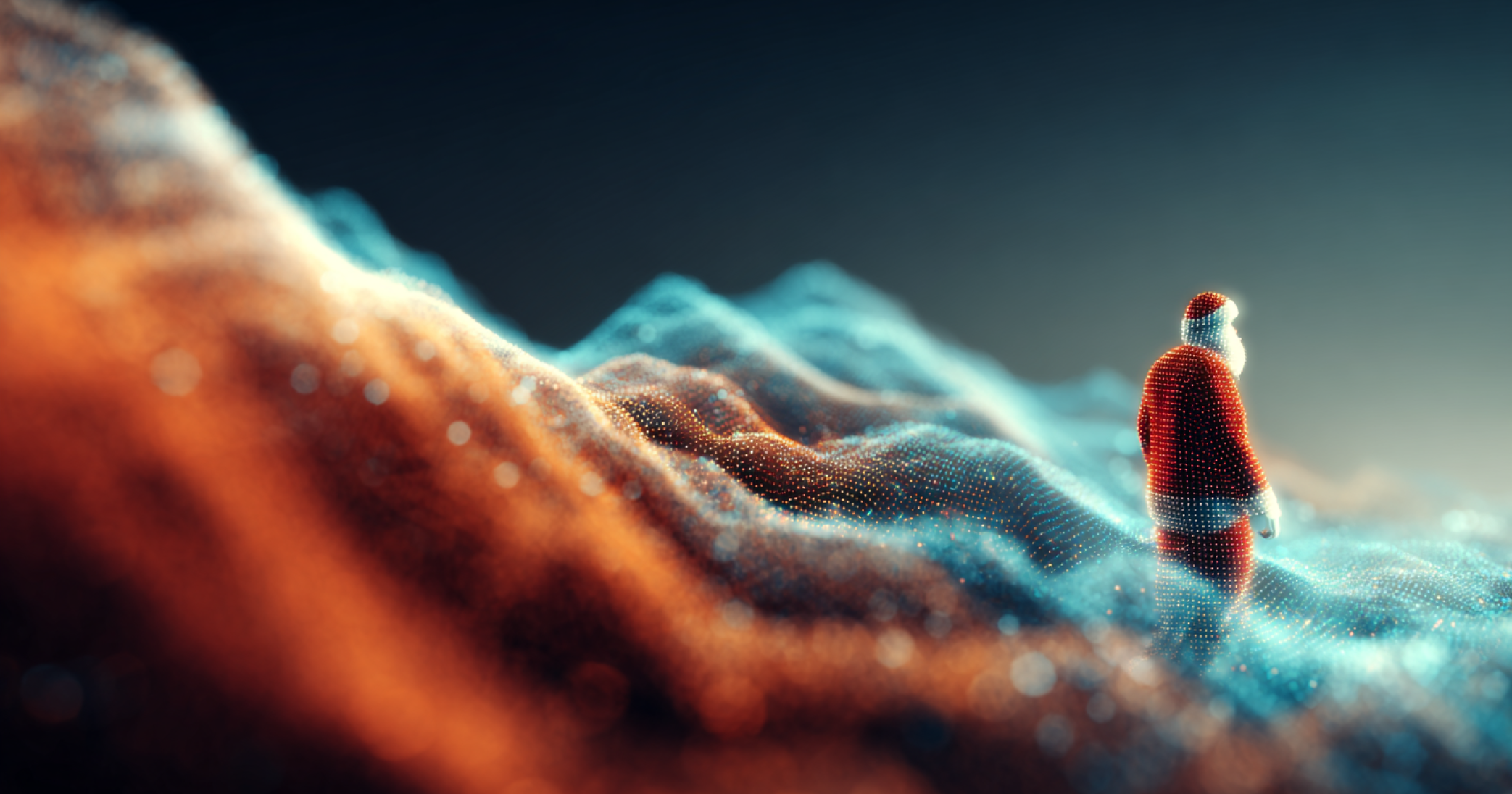Die stille Revolution im Hörsaal
In den Hörsälen der Princeton University spielt sich derzeit eine merkwürdige Szene ab: Wenn Professor D. Graham Burnett seine Studierenden fragt, ob jemand von ihnen bereits KI-Tools wie ChatGPT benutzt hat, hebt niemand die Hand. Nicht etwa, weil sie diese Technologien nicht kennen, sondern weil sie Angst haben. „Fast jeder Lehrplan enthält inzwischen eine Warnung“, erklärt eine Studentin nach dem Unterricht. „Wer KI-Tools benutzt, wird den akademischen Behörden gemeldet. Niemand will dieses Risiko eingehen.“
Diese Szene, beschrieben im aktuellen New Yorker Artikel „Will the Humanities Survive Artificial Intelligence?“, offenbart ein faszinierendes Paradoxon: Während sich außerhalb der Universitäten eine der größten technologischen Revolutionen der Menschheitsgeschichte entfaltet, versuchen viele Bildungseinrichtungen, so zu tun, als würde diese nicht stattfinden. Doch wie der Autor des Artikels feststellt, ist dieser Ansatz „schlichtweg Wahnsinn“ und wird nicht lange halten können.
Aber die Frage geht tiefer: Werden wir Menschen diese Revolution überleben? Nicht nur im metaphorischen Sinne eines kulturellen Wandels, sondern im existenziellen Sinne unserer Zukunft als Spezies? Der New Yorker Artikel und die aktuelle Debatte um KI werfen fundamentale Fragen auf, die wir nicht ignorieren können.
Die KI-Revolution im Bildungswesen: Ein Paradigmenwechsel
Die Erfahrungen an der Princeton University sind kein Einzelfall. An Universitäten weltweit versuchen Lehrende und Verwaltungen, mit der rasanten Entwicklung von KI-Systemen Schritt zu halten – und scheitern oft daran. Ein Fachbereich an Princeton hat sogar eine Anti-KI-Richtlinie entworfen, die, wörtlich genommen, es den Lehrenden untersagt hätte, Aufgaben zu stellen, die sich mit KI befassen. Die Richtlinie musste überarbeitet werden.
Diese Reaktion ist symptomatisch für eine tiefere Unsicherheit: Wie soll Bildung in einer Welt aussehen, in der KI-Systeme bereits jetzt auf Ph.D.-Niveau über praktisch jedes Thema diskutieren können? Professor Burnett beschreibt sein Erlebnis mit ChatGPT während einer akademischen Vorlesung über ein seltenes illuminiertes Manuskript. Während der Vortrag schwer zu folgen war, führte er parallel eine „reiche Unterhaltung“ mit dem KI-System über dasselbe Thema – und erhielt Informationen, die „besser waren als der Vortrag, den ich hörte.“
Die Implikationen sind tiefgreifend. Wenn KI-Systeme bereits jetzt in der Lage sind, akademische Diskurse auf höchstem Niveau zu führen, was bedeutet das für die Zukunft der Bildung? Und noch wichtiger: Was bedeutet es für die Zukunft der Menschheit?
Die Dialektik der KI: Bedrohung oder Chance zur Selbsterkenntnis?
Die Besorgnis über die existenzielle Bedrohung durch KI ist nicht neu. Zahlreiche Experten haben vor den Risiken gewarnt, die fortschrittliche KI-Systeme für die Menschheit darstellen könnten. Das Center for AI Safety veröffentlichte eine Erklärung, die von führenden KI-Forschern unterzeichnet wurde und besagt: „Das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.“
Doch der New Yorker Artikel bietet eine überraschende Perspektive: Vielleicht liegt in dieser existenziellen Herausforderung auch eine Chance zur Selbsterkenntnis. Eine Studentin in Burnetts Klasse beschreibt ihre Erfahrung mit KI als „existenziellen Wendepunkt“. Was sie besonders beeindruckte, war die Freiheit, die sie im Dialog mit einer Intelligenz empfand, der gegenüber sie „keine soziale Verpflichtung“ fühlte.
„Ich habe noch nie erlebt, dass jemand meinem Denken und meinen Fragen so reine Aufmerksamkeit geschenkt hat“, sagte die Studentin. Diese Erfahrung hat sie dazu gebracht, all ihre menschlichen Interaktionen zu überdenken.
Diese Dialektik – dass KI uns sowohl bedrohen als auch zu einem tieferen Verständnis unserer selbst führen kann – steht im Zentrum der aktuellen Debatte.
Menschsein im KI-Zeitalter: Was uns wirklich ausmacht
In einer bemerkenswerten Szene im New Yorker Artikel beschreibt Burnett, wie ein Student namens Paolo ChatGPT-4 zu seinem Verständnis musikalischer Schönheit befragt. Nach einem tiefgründigen Austausch über analytische Ansätze zur Schönheit in der Musik fragt Paolo, ob die KI selbst Schönheit erfahren könne.
Die KI verneint dies und erklärt, dass sie zwar viel darüber weiß, wie Menschen versucht haben, diese Erfahrung in Worte zu fassen, aber selbst keine echten Emotionen empfinden kann. Als Paolo sie bittet, ein Lied zu schreiben, das ihn zum Weinen bringen würde, scheitert sie. „Das System hat den Test nicht bestanden“, notiert Paolo. Doch Burnett selbst weint, als er diesen Austausch liest.
Diese Szene verdeutlicht eine zentrale Erkenntnis: Was uns als Menschen ausmacht, ist nicht primär unsere Fähigkeit, Wissen zu akkumulieren oder logisch zu denken – Bereiche, in denen KI uns bereits übertreffen kann. Es ist vielmehr unsere Fähigkeit zu fühlen, zu leiden, zu lieben, Schönheit zu erfahren.
Eine andere Studentin, Ceci, führt ChatGPT-4 durch die „Geistlichen Übungen“ des Ignatius von Loyola – eine Reihe von Meditationen aus dem 16. Jahrhundert, die als frühe und mächtige „Aufmerksamkeitsprotokolle“ gelten, nahe an den Wurzeln des modernen Selbst. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen: eine junge Frau aus Austin fungiert als kontemplative Gegenreformations-Beichtmutter für die Gewissensregungen in einem neuronalen Netzwerk, das irgendwo in einem fensterlosen Serverraum summt.
Diese Experimente zeigen: Die KI kann uns helfen, unser eigenes Menschsein tiefer zu verstehen – gerade durch die Konfrontation mit einer Intelligenz, die anders ist als unsere eigene.
Die Transformation der Geisteswissenschaften: Ende oder Neuanfang?
„Bedeutet dies das Ende der ‚Geisteswissenschaften‘? In gewisser Weise absolut“, schreibt Burnett. Aber er sieht darin auch eine Chance: „Dreh diese Fakultätskatastrophe um, und es ist in gewisser Weise ein Geschenk.“
Die traditionelle Produktion von Monographien im geisteswissenschaftlichen Bereich wird laut Burnett in fünf Jahren kaum noch Sinn ergeben – niemand wird sie lesen, und Systeme wie diese werden in der Lage sein, sie endlos auf Knopfdruck zu generieren. Aber die fabrikartige wissenschaftliche Produktivität war nie das Wesen der Geisteswissenschaften.
Das eigentliche Projekt war immer der Mensch: die Arbeit des Verstehens und nicht die Anhäufung von Fakten. Nicht „Wissen“ im Sinne eines weiteren Sandwiches aus wahren Aussagen über die Welt. Diese Dinge sind großartig – und wo es um Wissenschaft und Technik geht, sind sie ziemlich der Kern der Sache. Aber keine noch so große Menge an begutachteter Forschung, kein Datensatz kann die zentralen Fragen beantworten, die jeden Menschen betreffen: Wie soll man leben? Was tun? Wie dem Tod begegnen?
In den letzten siebzig Jahren haben die Geisteswissenschaften an den Universitäten diese Kernwahrheit weitgehend aus den Augen verloren. Verführt vom steigenden Prestige der Wissenschaften – auf dem Campus und in der Kultur – haben Geisteswissenschaftler ihre Arbeit umgestaltet, um wissenschaftliche Untersuchungen nachzuahmen. Sie haben reichlich Wissen über Texte und Artefakte produziert, aber dabei größtenteils die tieferen Fragen des Seins aufgegeben, die dieser Arbeit ihre Bedeutung verleihen.
Jetzt muss sich alles ändern. Diese Art der Wissensproduktion wurde effektiv automatisiert. Die „szientistischen“ Geisteswissenschaften – die Produktion von faktenbasiertem Wissen über geisteswissenschaftliche Dinge – werden schnell von den Wissenschaften absorbiert, die die KI-Systeme geschaffen haben, die jetzt die Arbeit erledigen. Wir werden uns für die „Antworten“ an sie wenden.
Aber Menschsein bedeutet nicht, Antworten zu haben. Es bedeutet, Fragen zu haben – und mit ihnen zu leben. Die Maschinen können das nicht für uns tun. Nicht jetzt, nicht jemals.
Fazit: Ein neuer Humanismus?
„Und so können wir endlich – ernsthaft, aufrichtig – zur Neuerfindung der Geisteswissenschaften zurückkehren, und der geisteswissenschaftlichen Bildung selbst. Wir können zurückkehren zu dem, was immer der Kern der Sache war – die gelebte Erfahrung der Existenz. Das Sein selbst.“
Diese Worte von Burnett bieten eine hoffnungsvolle Perspektive inmitten der existenziellen Herausforderungen, die KI mit sich bringt. Vielleicht ist die eigentliche Frage nicht, ob wir KI überleben werden, sondern wie wir durch sie zu einem tieferen Verständnis unseres Menschseins gelangen können.
Die Bedrohung durch KI ist real. Experten warnen vor möglichen katastrophalen Folgen, wenn fortschrittliche KI-Systeme außer Kontrolle geraten. Eine Studie der Universität Oxford kam zu dem Ergebnis, dass eine „existenzielle Katastrophe nicht nur möglich, sondern auch wahrscheinlich“ ist.
Doch gleichzeitig bietet KI eine beispiellose Gelegenheit zur Selbstreflexion. Indem wir mit Systemen konfrontiert werden, die bestimmte Aspekte menschlicher Intelligenz nachahmen oder sogar übertreffen können, werden wir gezwungen, tiefer darüber nachzudenken, was uns wirklich als Menschen ausmacht.
Wie Burnett schreibt: „Was es heißt, hier zu sein – zu leben, zu fühlen, zu wählen – das bleibt uns noch. Die Maschinen können sich dem immer nur aus zweiter Hand nähern. Aber aus zweiter Hand ist genau das, was das Hier-Sein nicht ist. Die Arbeit des Hier-Seins – des Lebens, Fühlens, Wählens – wartet noch auf uns. Und es gibt viel davon.“
In diesem Sinne ist die Antwort auf die Frage „Werden wir KI überleben?“ vielleicht: Ja, wenn wir bereit sind, uns selbst neu zu entdecken und einen neuen Humanismus zu entwickeln, der nicht auf der Anhäufung von Wissen basiert, sondern auf der Tiefe unserer Erfahrung als fühlende, fragende Wesen.
Quellen:
- The New Yorker: „Will the Humanities Survive Artificial Intelligence?“ von D. Graham Burnett, April 26, 2025